Kirche und Diakonie zum dritten Jahrestag des Angriffskriegs auf die Ukraine
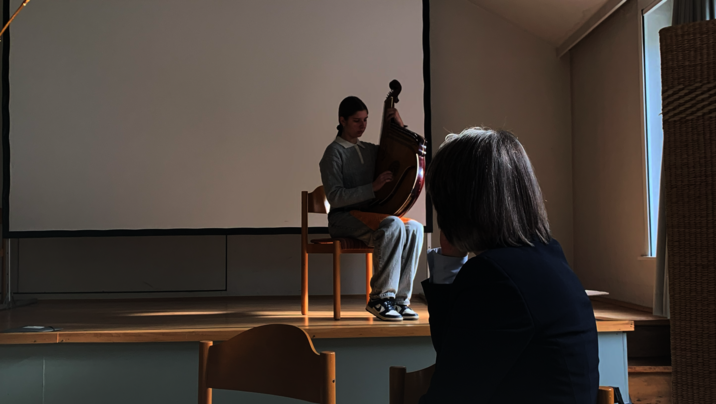
Landeskirche und Diakonie in Württemberg hatten eingeladen, sich auszutauschen – über Chancen, Herausforderungen und Geleistetes im Miteinander von Zivilgesellschaft und Geflüchteten seit Beginn des Ukraine-Kriegs.
Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller riefen dazu auf, im Engagement für die Menschen in und aus der Ukraine, aber auch in der Hoffnung auf Frieden, nicht nachzulassen. Pfarrer Dietrich Brauer, der in Moskau tätig war, beteiligte sich mit einem theologischen Impuls
Matthias Rose, Leiter der Abteilung Migration und Internationale Diakonie im Diakonischen Werk Württemberg, sagte: „Die Weltlage ist durch eine populistische, nationalistische und fremdenfeindliche Politik und durch den Krieg in Europa eine andere geworden, unser Auftrag als Christen ist es, uns für den Frieden und jede Form von Dialog einzusetzen.“ Er berichtete vom Engagement von Kirche und Diakonie, von Lehrkräften und anderen, sich für Friedenserziehung gegen die Diskriminierung russischer Schülerinnen und Schüler einzusetzen.
An fünf Tischen fanden Kurzvorstellungen, Gespräche und Vorträge statt. Rechtsanwältin Marina Walz-Hildebrand informierte zur aktuellen Rechtslage und besonders zur Aufenthaltssicherung Geflüchteter aus der Ukraine, Diakon Pétur Thorsteinsson über „Hoffnung für Osteuropa“, Ulrich Hirsch über die Aktivitäten des Gustav-Adolf-Werks, Traumatherapeutinnen vom Kirchenkreis Stuttgart berichteten von ihrer Arbeit mit ukrainischen Geflüchteten, Mitarbeitende des Evangelischen Asylbüros Stuttgart über „Ukraine – 3 Jahre danach“.
Zwei Projekte standen im Mittelpunkt der Vorstellung von Diakon Pétur Thorsteinsson, Geschäftsführer der württembergischen Spendenaktion „Hoffnung für Osteuropa“. Einerseits das Brückenprojekt „Wangen in Allgäu mit Cherson“, für die ACK in Wangen und Hoffnung für Osteuropa in den vergangen drei Jahren 78.000 Euro an Kooperationspartner in der Ukraine „Stiftung Spiritual Revival“ überweisen konnten. Größter Teil der Hilfen war für Menschen in den besetzten Gebieten und in den umkämpften Regionen an der Front. Die Strategie von „Hoffnung für Osteuropa“, sich auf finanzielle Unterstützung zu konzentrieren, machte diese Hilfe möglich. Ein Transport von Hilfsgütern wäre in dieser Zeit in diese Gebiete fast unmöglich gewesen. Vor Ort besorgten die einheimischen Ehrenamtlichen des Brückenprojekts Lebensmittel und Medikamente für Menschen in Not . Viel Wert wurde auf die Förderung von Solidarität gelegt, was dazu führte, dass mehr und mehr Leute sich gegenseitig halfen und die Community der Brückenbauer wuchs.
Das ist auch die Grundidee eines Projekts, für die in der Diakonie Württemberg Ann-Kathrin Hartter, Referentin der württembergischen Landesstellen Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt, zuständig ist. Mit einer Förderung des Staatsministeriums, des Landtags und eines Eigenanteils von Hoffnung für Osteuropa wird die neu gegründete Organisation „DKH Kiew“ unterstützt, um es kleinen Vereinen vor Ort zu ermöglichen, sicher und selbständig den Menschen in der Ukraine zur Seite zu stehen.
